Was ist eine Erhaltungssatzung - und warum betrifft sie dich als Immobilienbesitzer?
Wenn du eine Wohnung in Berlin, München oder Hamburg besitzt, hast du vielleicht schon davon gehört: Erhaltungssatzung. Aber was genau bedeutet das für dich? Es ist kein bloßer bürokratischer Zusatz - es ist ein rechtlicher Rahmen, der entscheidet, was du mit deiner Immobilie tun darfst und was nicht. Diese Satzungen wurden nicht erfunden, um Eigentümer zu ärgern. Sie sollen verhindern, dass ganze Stadtteile durch teure Modernisierungen und Umwandlungen in Eigentumswohnungen verdrängt werden. Die soziale Mischung, die diese Viertel ausmacht, soll erhalten bleiben. Doch für dich als Eigentümer heißt das: Du kannst nicht mehr einfach deine Wohnung sanieren, zusammenlegen oder umwandeln, ohne vorher die Genehmigung der Stadt einzuholen.
Die rechtliche Grundlage dafür ist das Baugesetzbuch (BauGB), genauer gesagt die Paragraphen 172 bis 174. Das heißt: Das ist kein lokales Spiel, sondern bundesweit geltendes Recht. Was sich unterscheidet, ist nur, wie streng jede Stadt es umsetzt. In München gibt es 36 solcher Gebiete, die 202.400 Wohnungen umfassen. In Berlin sind es über 20 Schutzgebiete, und die Zahl steigt. 2022 wurden allein 15 neue Milieuschutzgebiete in Deutschland eingeführt. Wenn du in einer Großstadt wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Viertel betroffen ist - oder bald sein wird.
Milieuschutz vs. Sanierungsgebiet: Was ist der Unterschied?
Viele verwechseln Erhaltungssatzungen mit Sanierungsgebieten. Das ist ein großer Fehler. Ein Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB greift ein, wenn ein Viertel schon marode ist: Risse in den Fassaden, kaputte Treppenhäuser, keine Heizung mehr. Da geht es um baulichen Zustand. Der Milieuschutz greift viel früher - und viel subtiler. Er schützt nicht die Wände, sondern die Menschen. Ein Viertel kann optisch noch perfekt sein, aber wenn die Mieten steigen, die Mieter verdrängt werden und nur noch Studenten und Besserverdienende einziehen, dann ist die soziale Struktur zerstört. Das ist der Punkt, an dem die Stadt mit einer Erhaltungssatzung eingreift.
Ein Beispiel: Der Letteplatz in Berlin ist seit 2018 unter Milieuschutz. Die Häuser sind alt, aber nicht marod. Die Mieter sind Arbeiter, Rentner, Familien - eine echte Mischung. Wenn ein Eigentümer jetzt eine Wohnung modernisieren will, darf er nicht einfach neue Badezimmer einbauen, Fußbodenheizung verlegen oder die Wohnung in zwei kleinere teilen. Alles das braucht Genehmigung. Und oft wird sie nicht erteilt, wenn die Maßnahme als „überzogen“ gilt. Das ist der Kern: Es geht nicht um den Zustand des Hauses, sondern um die Wirkung auf die Nachbarschaft.
Was genau ist genehmigungspflichtig? Die 5 größten Fallstricke
Wenn du in einem Milieuschutzgebiet wohnst, dann musst du mit einer einfachen Regel leben: Alles, was du veränderst, könnte genehmigungspflichtig sein. Die meisten Eigentümer unterschätzen das. Hier sind die fünf häufigsten Fallstricke:
- Zusammenlegung von Wohnungen: Zwei kleine Wohnungen zu einer großen machen? Das ist in den meisten Fällen verboten. Die Stadt will nicht, dass große Wohnungen entstehen, die nur noch für Wohlhabende erschwinglich sind.
- Umwandlung in Eigentumswohnungen: Das ist der größte Feind des Milieuschutzes. In München sank die Umwandlungsquote in Schutzgebieten von 12,3% (2010) auf nur noch 4,7% (2022). In nicht geschützten Gebieten stieg sie dagegen auf 14,2%. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht - sie kann dir das Grundstück abkaufen, wenn du verkaufen willst.
- Hochwertige Modernisierungen: Ein neues Bad? Normal. Aber wenn du Fußbodenheizung einbaust, doppelte Verglasung, teure Küchen oder Smart-Home-Systeme, dann ist das oft „überzogen“. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin (8 K 12345/22) aus Februar 2023 klärte: Wenn die Miete nach der Sanierung um mehr als 15% steigt, ist es genehmigungspflichtig - und meist abgelehnt.
- Abriss oder Erweiterung: Selbst kleine Anbauten oder Dachgeschossausbauten brauchen Genehmigung. Und sie werden fast immer abgelehnt, wenn sie den Charakter des Viertels verändern.
- Neubau auf unbebauten Flächen: Wenn du ein Grundstück hast, das leer ist, darfst du nicht einfach ein neues Haus bauen. Die Stadt kann das Vorkaufsrecht ausüben oder den Bau komplett verbieten, wenn er nicht zur bestehenden Bebauung passt.
Ein Eigentümer aus Prenzlauer Berg berichtete auf Immobilienscout24: „Mein Antrag auf Zusammenlegung dauerte 9 Monate - statt der versprochenen 3.“ Das ist keine Ausnahme. In Berlin dauert die Bearbeitung durchschnittlich 180 Tage. In Hamburg, wo die Verwaltung digitalisiert hat, sind es nur 90 Tage. Aber egal wo: Die Wartezeit kostet Geld. Und oft kommt die Antwort: „Nein.“

Wie viel kostet es, wenn du gegen die Regeln verstößt?
Einige Eigentümer denken: „Ich mache das einfach, und die Stadt merkt es nicht.“ Das ist ein gefährlicher Irrtum. Die Stadt hat nicht nur ein Amt, das die Anträge prüft - sie hat auch Mieter, die melden, wenn jemand etwas verändert. Und sie hat Bauprüfer, die regelmäßig durch die Straßen gehen.
Wenn du ohne Genehmigung eine Wohnung umgebaut hast, dann drohen dir:
- Rückbau: Du musst alles wieder in den Originalzustand versetzen. Das kostet oft doppelt so viel wie die ursprüngliche Sanierung.
- Bußgelder: Bis zu 50.000 Euro können fällig werden - je nach Schwere des Verstoßes.
- Verkaufshemmnisse: Wenn du deine Wohnung verkaufen willst, musst du den neuen Käufer über alle baulichen Veränderungen informieren. Wenn du ohne Genehmigung gebaut hast, kann der Kaufvertrag angefochten werden.
- Keine Fördermittel: Kein KfW-Zuschuss, keine Steuerabschreibung - wenn du nicht genehmigt hast, bekommst du keine staatliche Unterstützung.
Rechtsanwalt Dr. Markus Puls aus Berlin sagt es klar: „Viele Eigentümer unterschätzen die Genehmigungsvorbehalte und riskieren teure Nachbesserungen oder sogar Rückbauten.“ Das ist kein theoretisches Risiko. Es passiert jeden Monat.
Wie du dich richtig vorbereitest - 4 Schritte für Eigentümer
Du willst sanieren? Du willst dein Haus modernisieren? Dann geh nicht einfach los. So gehst du richtig vor:
- Prüfe, ob dein Viertel betroffen ist. Gehe auf die Website deiner Stadt. München hat ein interaktives Kartenportal. Berlin zeigt die Schutzgebiete im Bezirksamt an. Wenn du unsicher bist, ruf beim Bauamt an - und frag nach: „Gehört meine Adresse zu einer Erhaltungssatzung?“
- Lies die konkrete Satzung. Jede Erhaltungssatzung ist anders. In einigen Gebieten ist der Einbau von Balkonen erlaubt, in anderen nicht. In einigen ist die Sanierung der Fassade mit Wärmedämmung erlaubt, in anderen nur mit historischen Materialien. Die Satzung steht immer online - und sie ist verbindlich.
- Beantrage vorab Beratung. Viele Städte bieten kostenlose Beratung an. In Berlin gibt es das „Milieuschutz-Telefon“ des Bezirksamts Reinickendorf - 85 Anfragen pro Woche werden bearbeitet. In Hamburg kannst du einen Termin im Stadtentwicklungsamt vereinbaren. Frag: „Welche Modernisierungen sind in meinem Gebiet erlaubt?“
- Rechne mit Verzögerungen. Plane mindestens 4-6 Monate für eine Genehmigung ein. Das ist keine Ausnahme, das ist die Regel. Und du brauchst immer einen Puffer für den Fall, dass die Stadt eine zusätzliche Prüfung verlangt.
Ein Eigentümer aus Freiburg berichtete: „Die Behörde hat mir sogar Fördermittel vermittelt, als ich eine energetische Sanierung beantragt habe.“ Das ist möglich - wenn du dich an die Regeln hältst. Die Stadt will nicht, dass du nichts tust. Sie will nur, dass du es richtig machst.
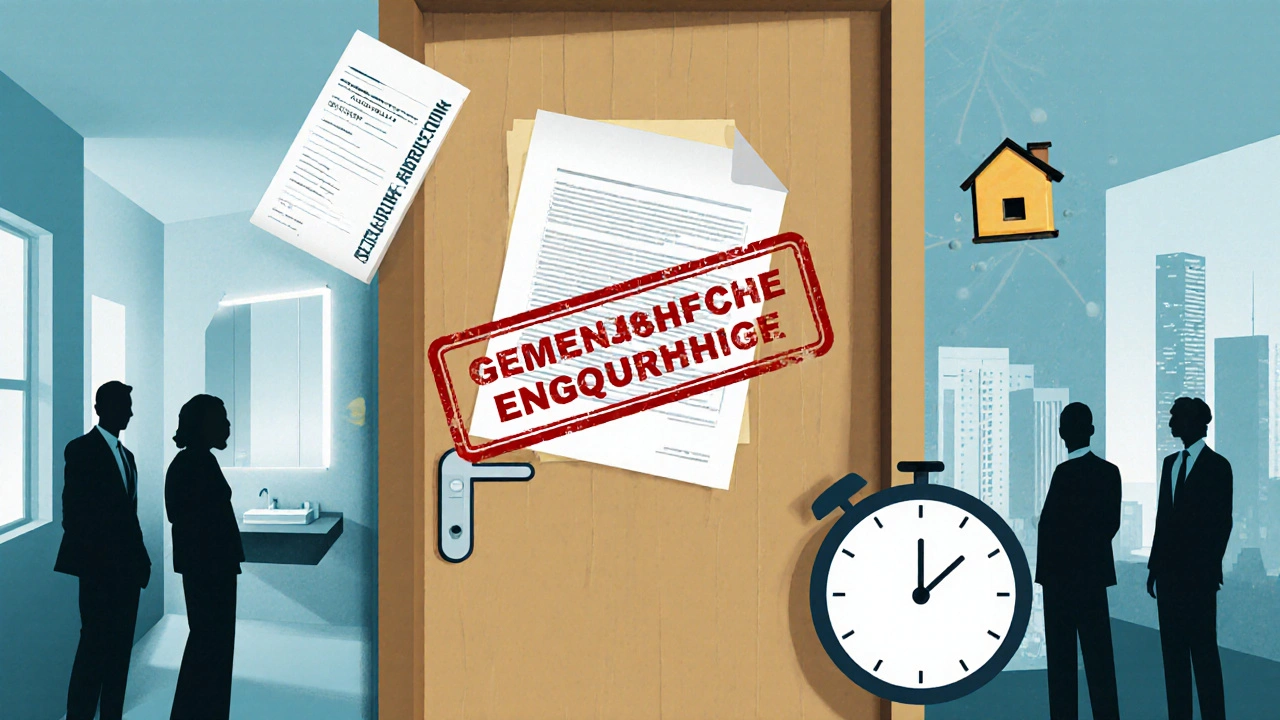
Die Zukunft: Wird Milieuschutz immer strenger?
Die Zahl der Milieuschutzgebiete steigt. 2022 wurden 15 neue hinzugefügt. Berlin plant bis Ende 2023 vier weitere. Der Deutsche Städtetag sagt: „Die Instrumente sind gesichert.“ Und das Bundesverwaltungsgericht hat 2010 klargestellt: Milieuschutz ist rechtlich zulässig - vorausgesetzt, er basiert auf konkreten, nachvollziehbaren städtebaulichen Zielen.
Aber es gibt auch Kritik. Professor Klaus Brunnengräber von der TU Dortmund warnt: „Überzogene Anwendung senkt die Sanierungsquote und beeinträchtigt langfristig die Wohnqualität.“ Wenn niemand mehr sanieren darf, weil alles genehmigungspflichtig ist, dann verfallen die Häuser. Die Mietpreise steigen trotzdem - weil kein neuer Wohnraum entsteht.
Die Lösung liegt nicht im Abschaffen, sondern in der Balance. Die Novelle des BauGB vom 1. Januar 2023 hat die Handlungsspielräume der Städte erweitert - aber auch die Anforderungen an Nachweise verschärft. Es geht nicht mehr um „wir wollen das Viertel schützen“, sondern um „wir haben nachgewiesen, dass hier soziale Verdrängung stattfindet“.
Der Trend ist klar: Milieuschutz wird nicht verschwinden. Er wird sich verfeinern. Und du als Eigentümer musst lernen, damit zu leben. Nicht als Feind, sondern als Partner der Stadt. Denn du willst auch, dass dein Viertel lebenswert bleibt - nur eben nicht zu teuer.
Was bleibt? Ein klarer Rat für Immobilienbesitzer
Wenn du in einer Großstadt wohnst und eine Immobilie besitzt, dann ist Milieuschutz kein Thema für die Zukunft. Es ist deine Realität. Du kannst nicht dagegen ankämpfen. Aber du kannst dich darauf vorbereiten.
Denk nicht an „was ich nicht darf“. Denk an „was ich mit der Stadt zusammen machen kann“. Frag nach Beratung. Lies die Satzung. Plane Zeit ein. Und wenn du sanierst - dann mache es so, dass die Stadt dich unterstützt, nicht bekämpft.
Die Mietpreisbremse in München, die 15%-Grenze für Mieterhöhungen, der Milieuschutz - das sind keine Angriffe auf Eigentümer. Das ist ein Versuch, eine Stadt zu erhalten, in der nicht nur die Reichen wohnen dürfen. Und wenn du das verstehst, dann wird deine Immobilie nicht nur legal, sondern auch langfristig wertvoller bleiben.







Schreibe einen Kommentar