Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihre Altbauwohnung in Berlin-Mitte verkaufen. Die KI-Bewertung sagt: 480.000 Euro. Ein menschlicher Gutachter sagt: 615.000 Euro. Wer hat recht? Die Antwort ist nicht einfach. Künstliche Intelligenz hat die Immobilienbewertung verändert - aber nicht ersetzt. Sie ist jetzt ein Werkzeug, das schneller, genauer und konsistenter arbeitet als je zuvor. Doch sie versteht noch nicht, warum ein Stuckfries oder eine geplante U-Bahn-Station den Wert einer Immobilie um 30 Prozent verändern kann.
Was KI heute in der Immobilienbewertung leistet
Heute (2025) übernimmt KI bereits 78 Prozent der routinemäßigen Datenauswertung bei Immobilienbewertungen. Das bedeutet: Sie scannt Hunderte von Transaktionen in Ihrer Straße, vergleicht die Quadratmeterpreise, prüft die Energieeffizienzklasse, analysiert die Entfernung zur nächsten Bushaltestelle und zieht sogar die durchschnittliche Wohnungsgröße im Viertel heran. Alles in Sekunden. Ein menschlicher Gutachter braucht dafür Tage.
Die Systeme arbeiten mit durchschnittlich 37 Merkmalen pro Immobilie. Das sind nicht nur Fläche und Zimmerzahl, sondern auch Mikrostandortdaten wie Lärmpegel, Grünflächen in 500-Meter-Radius, Schulen in der Nähe und sogar die Anzahl der Parkplätze pro Gebäude. Die Genauigkeit bei Standard-Einfamilienhäusern in etablierten Lagen liegt bei 88,7 Prozent - fast perfekt. In München, Hamburg oder Berlin erreichen die besten KI-Modelle bei einfachen Wohnungen sogar nur 5,3 Prozent Abweichung vom tatsächlichen Verkaufspreis.
Diese Systeme lernen aus einer Million Immobilientransaktionen pro Jahr, die von den Gutachterausschüssen erfasst werden. Sie nutzen Deep Learning, also künstliche neuronale Netze, die Muster erkennen, die Menschen nie sehen würden. Ein Algorithmus kann beispielsweise feststellen, dass Wohnungen mit 3,80 Meter Deckenhöhe in Leipzig-Süd seit 2022 durchschnittlich 12 Prozent mehr wert sind - ohne dass jemand ihm das gesagt hat.
Wo KI versagt - und warum der Mensch noch unverzichtbar ist
Die größte Schwäche von KI ist nicht Technik, sondern Kontext. Sie kann nicht fühlen, was ein Viertel ausmacht. Sie weiß nicht, dass die alte Bäckerei am Eck, die vor drei Monaten geschlossen hat, bald zu einem Co-Working-Space wird. Sie versteht nicht, dass die geplante Sanierung des historischen Stadtkerns in Frankfurt die Nachfrage nach Altbauten in den nächsten fünf Jahren nach oben treiben wird.
Praktische Tests zeigen: Bei komplexen Immobilien - denkmalgeschützte Häuser, Bauernhöfe mit Nebengebäuden, Wohnungen mit ungewöhnlicher Grundrissgestaltung - liegt die Genauigkeit von KI bei nur 82,3 Prozent. Menschliche Gutachter erreichen hier 94,1 Prozent. Warum? Weil sie wissen, dass ein Stuckfries aus den 1920ern nicht nur Dekoration ist, sondern ein signifikantes Verkaufsargument für eine bestimmte Käufergruppe. Weil sie wissen, dass eine Wohnung mit 120 Quadratmetern in einer Straße mit nur drei Verkäufen seit 2020 nicht einfach mit der Durchschnittspreislinie berechnet werden kann.
Ein Nutzer berichtet auf Trustpilot: „Die KI hat meinen Altbau in Berlin-Mitte um 28 Prozent unterschätzt. Sie hat nicht erkannt, dass die Nachfrage nach historischen Wohnungen gerade stark steigt.“ Solche Fehler sind keine Ausnahme. 74 Prozent der negativen Bewertungen auf Google Reviews beziehen sich auf falsche Werte, weil KI Infrastrukturprojekte, Sanierungspläne oder soziale Veränderungen im Viertel nicht erfasst.
Die hybride Lösung: KI als Assistent, Mensch als Entscheider
Die erfolgreichsten Unternehmen arbeiten heute nicht mit KI statt Gutachtern, sondern mit ihnen. Sie haben eine neue Rolle geschaffen: den „KI-Interpreter“. Diese Person versteht Technik und Immobilien. Sie prüft die KI-Ergebnisse, filtert die irrelevante Datenrauschen und entscheidet, welche Faktoren der Algorithmus übersehen hat.
Sprengnetter Real Estate Services, einer der Vorreiter, hat 73 Prozent ihrer Bewertungsprozesse so umgestellt. Die KI liefert die Zahlen, der Mensch interpretiert die Geschichte dahinter. So spart man Zeit, ohne Qualität zu verlieren. Und das ist der Schlüssel: KI macht die Arbeit schneller. Der Mensch macht sie richtig.
92 Prozent der finalen Entscheidungen bei komplexen Bewertungen werden noch von Menschen getroffen - und das wird bis 2030 so bleiben, wie 87 Prozent der Gutachter prognostizieren. Die Zukunft gehört nicht der KI oder dem Menschen, sondern der Kombination.
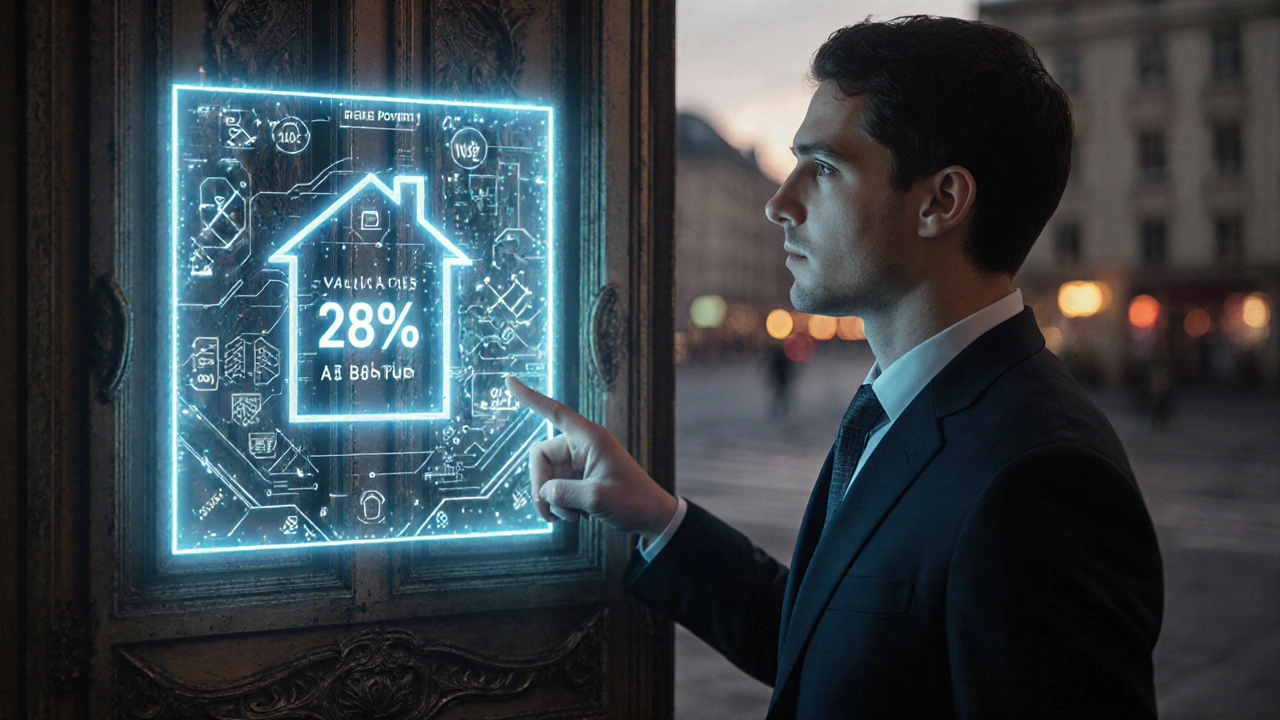
Kosten, Implementierung und technische Voraussetzungen
Eine professionelle KI-Bewertungssoftware kostet zwischen 1.250 und 8.500 Euro pro Monat. Kleinere Maklerbüros mit unter 10 Mitarbeitern investieren selten - nur 29 Prozent nutzen solche Tools. Große Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern hingegen haben eine Quote von 82 Prozent.
Die Integration ist der größte Hürde. 68 Prozent der Firmen kämpfen mit alten Systemen aus den 1960er Jahren, die nicht mit modernen APIs kommunizieren können. Die Anbindung an Immobilienportale wie ImmobilienScout24 oder den Engel & Völkers Data Hub braucht durchschnittlich 14,5 Wochen. Und das ist nur die technische Seite.
Ein Mitarbeiter braucht durchschnittlich 87 Stunden Schulung, um KI-Tools richtig zu nutzen. Die meisten Unternehmen haben keine klaren Regeln dafür, wie KI eingesetzt werden darf. 63 Prozent verfügen über keine Governance-Richtlinien. 57 Prozent haben kein Schulungsprogramm. Das führt dazu, dass viele KI-Tools nur als „Digitalisierungs-Showcase“ laufen - ohne echten Nutzen für den Alltag.
Der Markt: Wachstum, Trends und rechtliche Unsicherheiten
Der Markt für KI in der Immobilienbewertung wächst rasant. 2024 lag der Umsatz bei 187 Millionen Euro, 2025 werden es bereits 254 Millionen Euro sein. 91 Prozent der Unternehmen sehen KI als Schlüsseltechnologie für die nächsten fünf Jahre. Doch das Wachstum ist ungleich verteilt.
In München und Berlin steigen die Preise wieder - KI hilft, diese Dynamik schnell zu erfassen. In strukturschwachen Regionen hingegen sinken die Werte, und KI kann nicht erklären, warum. Sie kann nur messen. Der Mensch muss sagen, ob das ein temporärer Einbruch ist oder das Ende einer Entwicklung.
Die deutsche Gesetzgebung hinkt hinterher. Die Gutachterausschüsse arbeiten mit Regeln aus dem BauGB, die vor 40 Jahren geschrieben wurden. Die DVW arbeitet an sieben konkreten Reformvorschlägen, um KI-gestützte Bewertungen rechtlich abzusichern. Bislang gibt es keine klare Definition: Ist eine KI-Bewertung ein Gutachten? Kann sie vor Gericht gelten? Wer haftet, wenn sie falsch liegt? Diese Fragen bleiben unbeantwortet - und das hemmt die breite Nutzung.

Was kommt als Nächstes? Generative KI und die Zukunft der Bewertung
Die nächste Stufe heißt generative KI. Diese Systeme können nicht nur Daten analysieren, sondern auch Szenarien simulieren. Stellen Sie sich vor, eine KI sagt: „Wenn die geplante U-Bahn-Linie 2027 fertig ist, steigt der Wert von Wohnungen in dieser Straße um durchschnittlich 18 Prozent. Wenn die Schule geschlossen wird, sinkt er um 12 Prozent.“
Das ist kein Science-Fiction. KPMG hat bereits erste Pilotprojekte mit solchen Modellen getestet. Sie sind noch nicht perfekt - aber sie zeigen, wohin die Reise geht. Bis 2027 wird KI 85 Prozent der Datenauswertung übernehmen. Der Gutachter wird dann nicht mehr Zahlen berechnen, sondern erklären, was diese Zahlen bedeuten. Er wird mit Kunden sprechen, Berichte schreiben, Risiken bewerten und lokale Entwicklungen einordnen.
Die KI wird die Arbeit erleichtern. Aber sie wird nie ersetzen, was Menschen am besten können: Verstehen, interpretieren, vertrauen aufbauen.
Frequently Asked Questions
Kann eine KI eine Immobilie wirklich richtig bewerten?
Eine KI kann Standardimmobilien in gut dokumentierten Lagen sehr genau bewerten - bis zu 88,7 Prozent Genauigkeit. Aber sie scheitert bei komplexen Fällen wie Denkmälern, ungewöhnlichen Grundrissen oder Gebieten mit starken sozialen Veränderungen. Sie erkennt Muster, aber nicht Kontext. Deshalb ist die finale Entscheidung immer noch menschlich.
Wie teuer ist eine KI-Bewertungssoftware?
Professionelle Tools kosten zwischen 1.250 und 8.500 Euro pro Monat. Kleinere Maklerbüros zahlen selten mehr als 2.000 Euro, während große Unternehmen mit Enterprise-Lösungen wie WuestPartner bis zu 8.500 Euro investieren. Die Kosten beinhalten meist Anbindung an Datenquellen, Updates und Support.
Wird die KI die Immobilien-Gutachter ersetzen?
Nein. 87 Prozent der Gutachter gehen davon aus, dass der Mensch bis 2030 weiterhin die finale Entscheidung bei komplexen Bewertungen trifft. KI übernimmt die schnelle Datenauswertung - der Mensch interpretiert die Gründe hinter den Zahlen. Die Zukunft ist hybride Zusammenarbeit, nicht Ersatz.
Warum sind KI-Bewertungen manchmal so falsch?
Weil KI nicht weiß, was in einem Viertel wirklich passiert. Sie erkennt keine geplanten U-Bahn-Linien, keine Sanierungsprojekte, keine Veränderung der Nachbarschaft. Sie sieht nur Zahlen. Wenn die Daten nicht aktuell oder unvollständig sind - etwa weil ein neuer Park noch nicht in den Behördendaten verzeichnet ist - dann liefert sie ein falsches Ergebnis.
Wie lange dauert es, KI in ein bestehendes Büro zu integrieren?
Im Durchschnitt braucht die Integration 14,5 Wochen. Die größten Hürden sind die Anbindung an alte Systeme aus den 1960er Jahren und die Qualität der Eingangsdaten. Viele Unternehmen haben noch keine klaren Regeln, wie KI eingesetzt werden soll - das verzögert die Umsetzung oft noch länger.
Was braucht man, um KI-Bewertungen zu nutzen?
Man braucht: Eine moderne Software, die mit Gutachterausschuss-Daten und Immobilienportalen wie ImmobilienScout24 verbunden ist, mindestens 16 GB RAM, eine GPU-Beschleunigung und Mitarbeiter, die mit den Tools umgehen können. Schulung ist entscheidend - durchschnittlich 87 Stunden pro Mitarbeiter. Ohne das ist KI nur ein teures Werkzeug, das niemand versteht.







Schreibe einen Kommentar